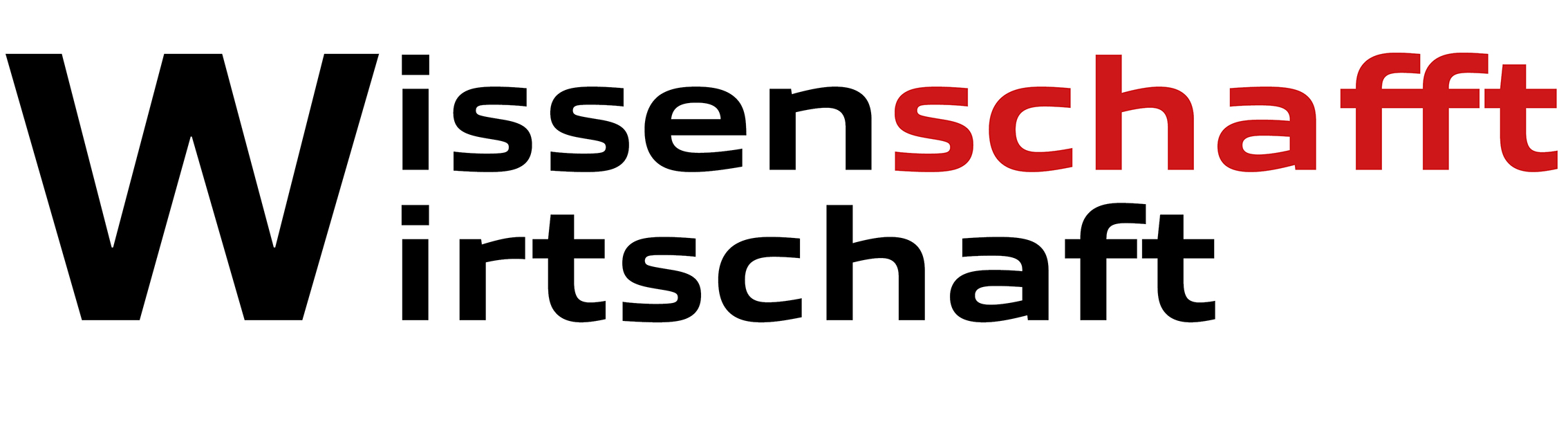
«Beide Seiten müssen aufeinander zugehen»
Für Prof. Dr. Christa Tobler, Professorin für Europarecht am Europainstitut der Universität Basel, ist klar, dass die EU und die Schweiz bei den institutionellen Fragen Kompromisse eingehen müssen.
Frau Tobler, ohne Klärung der institutionellen Fragen will die EU der Schweiz den Zugang zum Binnenmarkt nicht mehr wie bisher gewähren. Die Medizintechnik hat dies bereits zu spüren bekommen. Wo stehen wir heute und welche Branchen sind davon als nächstes betroffen?
Die Abkommen, von denen wir jetzt sprechen, sind nicht dynamisch. Die Parteien haben sich nicht verpflichtet, neues relevantes EU-Recht in die Abkommen zu übernehmen. Die Schweiz hat zum Beispiel «Nein» gesagt zur Anpassung des Personenfreizügigkeitsabkommen an die berühmte Unionsbürgerrichtlinie der EU. Und nun ist auf der anderen Seite das Gleiche geschehen: Die EU lehnt es ab, das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen von Produkten zu aktualisieren. Sie verhält sich hier rechtlich korrekt, auch wenn das für die Schweiz unbequem ist. Dieses Abkommen ist für die Wirtschaft und den grenzüberschreitenden Handel enorm wichtig, denn es beseitigt wesentliche Schranken im Warenhandel. Das gilt nun aber wegen der Haltung der EU nicht mehr für die Medizinalprodukte. Dasselbe kann in der Zukunft auch für andere Produktarten geschehen, nämlich dann, wenn die EU ihr eigenes Recht in diesem Bereich anpasst und dann die Aktualisierung des Abkommens verweigert. Die nächste Branche, die davon betroffen sein könnte, ist die Maschinenbranche, vermutlich im Jahr 2024.
Auch die Forschung ist ein Opfer der aktuellen Beziehungskrise. Glauben Sie noch daran, dass die EU die Schweiz in absehbarer Zeit wieder voll an Horizon Europe teilnehmen lässt?
Die EU hat zeitlich beschränkte Forschungsprogramme, die sie alle paar Jahre neu auflegt. Gewisse Nichtmitgliedstaaten können sich daran beteiligen, indem sie Verträge schliessen, so grundsätzlich auch die Schweiz. Jetzt sind wir aber wegen der institutionellen Fragen in einer Situation, in der die EU gesagt hat, dass zuerst in jenem anderen Bereich Schritte gemacht werden müssen, bevor wir in der Forschung gemeinsam weitermachen können. Unsere Diplomatie in Bern macht sich darüber grosse Sorgen. Die Schweiz sondiert zwar mit der EU aktuell, in welche Richtung eine Neuauflage der institutionellen Fragen gehen könnte, aber konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Die EU braucht die Forschungszusammenarbeit als einen Hebel, das ist ein politischer Schachzug.
In seinem Europabericht vom letzten Dezember kommt der Bundesrat zum Schluss, dass er am bilateralen Weg mit der EU festhalten will. Teilen Sie den Optimismus des Bundesrats in Bezug auf die Zukunft des bilateralen Wegs oder müssten wir jetzt nicht Alternativen wie etwa den Europäischen Wirtschaftsraum EWR ernsthaft prüfen?
Der Bundesrat kommt alle paar Jahre zum immer gleichen Schluss, nämlich dass für die Schweiz der bilaterale Weg der Beste ist. Wenn dieser funktioniert, ist das gut. Aber wenn es schwierig wird, muss man sich schon Gedanken machen über Alternativen. An einem Ende des Spektrums ist der EU-Beitritt, den ich für völlig unrealistisch und auch nicht für nötig halte. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es die Abschaffung des ganzen bilateralen Rechts. Dies wäre sehr schädlich für die Schweiz. Ein Mittelweg wäre die Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum EWR. Das würde unsere institutionellen Probleme auf einen Schlag lösen und unsere Position insgesamt verbessern. Die EU ist sehr zufrieden mit dem EWR und auch die Länder, die mitmachen – Island, Norwegen und Liechtenstein – leben gut damit. Der Bundesrat hat den EWR-Beitritt jedoch immer strikt abgelehnt. Ich finde das schade, weil es eine sehr gute Alternative ist. Allerdings müsste man dann in der Schweiz noch mehr Überzeugungsarbeit leisten, weil diverse heikle Punkte, die sich beim Institutionellen Abkommen gezeigt haben, dort ebenso vorhanden sind. Wir hätten wirtschaftlich gesehen eine viel bessere Lösung, aber sie würde auch institutionell weitergehen.
 Gabriel Schweizer, Leiter Aussenwirtschaft bei der Handelskammer beider Basel, im Gespräch mit Prof. Dr. Christa Tobler.
Gabriel Schweizer, Leiter Aussenwirtschaft bei der Handelskammer beider Basel, im Gespräch mit Prof. Dr. Christa Tobler.
Die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats forderte jüngst vom Bundesrat, dass er die Sondierungsgespräche mit der EU rasch abschliesst und bereits im ersten Halbjahr 2023 mit neuen Verhandlungen beginnt. Ist dieser Zeitplan realistisch?
Diese Forderung hat wohl politische Gründe: Wir haben ein Wahljahr, und ein Jahr später sind in der EU Wahlen. Wenn in der EU die Institutionen und Personen ändern, müssten die Beziehungen neu geschaffen werden, und das wäre aufwändig. Deshalb gibt es den Wunsch, bis zum Sommer einen klaren Weg einzuschlagen. Ob das realistisch ist oder nicht, lässt sich jetzt nicht beurteilen. Ich höre aus Bern, dass man bei gewissen Punkten Fortschritte gemacht hat, aber auch, dass es zu anderen Punkten noch keine Lösungen gibt. Es braucht einen Kompromiss, für den beide Seiten aufeinander zugehen müssen. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt, dass die EU auch wegen des Brexit gewisse Prinzipien härter verteidigt. Für einzelne Punkte gibt es Anzeichen, dass die EU der Schweiz entgegenkommen könnte, aber ob das reicht, müssen wir abwarten.
Weshalb dauern die Sondierungen so lange und um welche Punkte geht es in diesen Gesprächen konkret?
Es geht zum einen um die staatlichen Beihilfen, also einen Teil des EU-Wettbewerbsrechts. In der EU geht man richtigerweise davon aus, dass der Wettbewerb nicht nur durch das Verhalten von Unternehmen gestört werden kann, sondern auch durch das Verhalten des Staates. Dafür kennt die EU ein Kontrollsystem. Das gibt es in unserer schweizerischen Tradition nicht. Ein weiterer Punkt ist politisch eher schwierig: die flankierenden Massnahmen. Hier geht es um Unternehmen, die für eine bestimmte Zeit in der Schweiz tätig sind und dafür eigenes Personal mitbringen. Es stellt sich die Frage, welche Regeln für diese Arbeitskräfte gelten. Dafür gibt es in der EU das sogenannte Entsenderecht. Meiner Meinung nach ist das moderne EU-Entsenderecht recht gut. Es geht davon aus, dass, wenn man jemanden in ein anderes Land schickt, die Person denjenigen Lohn bekommen muss, der in diesem Gastland gilt. Wir haben in unserem bilateralen Recht EU-Entsenderecht übernommen, aber zurzeit noch nicht die moderne Variante des EU-Rechts. Die Gewerkschaften der Schweiz sind sehr kritisch eingestellt. Sie sind der Meinung, dass vor allem die Rolle des Europäischen Gerichtshofes bei der Auslegung des Entsenderechts problematisch sei. Ich finde, das EU-Recht hat sich in die richtige Richtung entwickelt, was sich auch auf die Rechtsprechung in die gleiche Richtung auswirken wird. Nach meiner Einschätzung kann die EU der Schweiz versichern, dass der Europäische Gerichtshof bei Sonderlösungen für die Schweiz in diesem Bereich nichts zu sagen hat. Aber die Maximalforderung der Gewerkschaften, dass dieser Gerichtshof gar nichts zu sagen hat, ist nach meiner rechtlichen Einschätzung nicht machbar. Ein dritter Punkt ist die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie. Hier ist die Frage eher auf der Seite der EU: Wie viel kommt sie der Schweiz entgegen? Wir erhalten Signale, dass sie hier zu mehr Sonderlösungen bereit ist als noch beim Institutionellen Abkommen, das der Bundesrat ablehnte.
Der Krieg in der Ukraine hat den europäischen Zusammenhalt gestärkt. Welche Auswirkungen hat diese Zeitenwende für die Beziehungen Schweiz-EU?
Die EU hat die Haltung der Schweiz zu diesem Krieg sehr positiv zur Kenntnis genommen. Das zeigt auch, dass die Schweiz und die EU die gleichen Grundwerte teilen. Es sollte genau dieser Ansatzpunkt sein, wo wir zusammenarbeiten müssen. Aber in der Schweiz gibt es auch eine Gegenbewegung, denken wir nur an die Neutralitätsinitiative der SVP. Sie will, vereinfacht gesagt, dass sich die Schweiz in solchen Fragen vollständig raushält. Das halte ich nicht für richtig. Ich glaube im Übrigen nicht, dass sich die übrigen Fragen wie die Forschungszusammenarbeit von selbst lösen werden. Die institutionellen Fragen und die ganze Binnenmarktproblematik bestehen weiter. Was mich persönlich betrübt, ist, dass es die Schweiz und die EU in Zeiten mehrfacher Krisen in wichtigen Bereichen nicht schaffen, pragmatisch zusammenzuarbeiten. Wir hätten in der Pandemie von einem Gesundheitsabkommen profitiert, und wir haben es nach wie vor nicht wegen der institutionellen Fragen. Jetzt haben wir die grosse Thematik der Energie, und wir haben kein Energieabkommen – wiederum wegen der institutionellen Fragen. Es scheint, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Aber wir hören, dass der nächste Winter eine echte Herausforderung werden kann. Um weiterzukommen, brauchen wir einen neuen institutionellen Rahmen.







